„Öffnen Sie das Buch auf Seite 99, und die Qualität des Ganzen wird sich Ihnen offenbaren.“ (Ford Madox Ford)
Wir lesen mit der Lupe und schauen, was der Text auf dieser Zufallsseite leistet.
(Warnung: Der Page-99-Test ersetzt keine Rezension.)
Meine Thomas Mann-Lektüren liegen weit zurück, ich bin mit diesem Großschriftsteller nie warm geworden. In meinem Germanistik-Studium war ich erschlagen von seinem stilistischem Können, zugleich wunderte ich mich, warum mich diese hoch virtuose Prosa so kalt ließ, manchmal ärgerte sie mich sogar (ähnlich ging es mir übrigens mit Goethe).
Die Seite 99 von Der Zauberberg wird mir auf dem Silbertablett serviert: ein Kapitelanfang, und am Ende auch noch ein vollständiger Satz. Wir erleben einen Wettersturz in Davos (der Ort muss auf der Seite nicht genannt werden, ist eh klar). In den Bergen nichts Seltenes, doch die Gesellschaft, der wir hier begegnen, rechnet damit offenbar nicht.
„Ist jetzt euer Sommer zu Ende?“ fragte Hans Castorp am dritten Tage ironisch seinen Vetter…
Der Satz, mit dem die Seite bzw. das Kapitel beginnt, ist eine Vorausschau. Zunächst wird der idyllische Tag davor geschildert.
Was auf dieser Seite sofort ins Auge springt, sind die Adjektive und Adverbien. Der Tag war „prächtig-sommerlich“ gewesen, das Geläut der Kühe erfüllt die Lüfte „heiter-beschaulich“ (bisschen manieriert, die Doppelungen), der Himmel leuchtet „tiefblau“. Die „Wipfeltriebe der Fichten“ sind „lanzenartig“, die Ortschaft im Tal „[schimmerte] grell in der Hitze“, die Kühe rupfen „das kurze, erwärmte Mattengras“. Ganze fünf Zeilen beherbergen diesen Reichtum, mit dem hier ein Sommertag gefeiert wird.
Eine ähnliche Adjektiv-Dichte findet sich im letzten Absatz der Seite, in dem der Wettersturz beschrieben wird: Die Sonne verbirgt sich „eilig“, „häßlich-torfbraunes Gewölk“ (schon wieder eine Doppelung) zieht über den Bergen herauf, der Wind ist „von fremder Luftbeschaffenheit, kalt und das Gebein erschreckend“, als käme er „aus unbekannten, eisigen Gegenden“. Vier Zeilen sind es diesmal.
Thomas Mann kann sich das sprachliche Beigemüse leisten – manches ist apart („lanzenartig“), anderes fast konventionell („heiter-beschaulich“, auch der „tiefblaue“ Himmel ist nicht besonders originell). In beiden Absätzen habe ich eine Lieblingsformulierung. Bei der Sommeridylle ist es das „erwärmte“ Mattengras, das mich die sommerliche Hitze, die ganze Opulenz dieses Tages unmittelbar spüren lässt. Beim Wettersturz ist es der Wind, der „kalt und das Gebein erschreckend“ herniederstürzt. Der Wind fährt einem nicht einfach „in die Knochen“, wie das Klischee es will, sondern er „erschreckt das Gebein“, außerdem ist er „von fremder Luftbeschaffenheit“.
In solchen Wendungen sitzt sprachliche Kreativität: Wetterphänomene, die wir alle kennen, werden so ausgedrückt, wie sie nur Thomas Mann formuliert.
Am dritten Tage […] war es genau, als ob die Natur zu Falle gebracht und jede Ordnung auf den Kopf gestellt würde […].
Mit diesen Worten wird der Wetterumsturz eingeleitet: „als ob die Natur zu Falle gebracht“ würde – diese Formulierung wirkt in ihrer leisen Weltuntergangsmetaphorik geradezu abgründig (wobei ich das Wörtchen „genau“ gern streichen würde). Zugleich ist es semantischer Unsinn: Schließlich ist auch der Temperatursturz Natur. Was zu Fall gebracht wird, ist nur die Ordnung; im zweiten Satzteil wird sie „auf den Kopf gestellt“. Gemeint ist die bürgerlich-penible Ordnung der hier versammelten Gesellschaft, deren luftiges Outfit im mittleren Absatz ausgiebig geschildert wird.
Zwischen den beiden adjektivgesättigten Passagen über das Wetter liegt eine ausgiebige Beschreibung dessen, was die Damen und Herren tragen. Hier ist der Ton ein anderer:
Die Damen waren schon zum ersten Frühstück in zarten Waschblusen erschienen, einige sogar mit durchbrochenen Ärmeln, was nicht alle gleich gut gekleidet hatte, – Frau Stöhr zum Beispiel kleidete es entschieden schlecht, ihre Arme waren zu schwammig, Duftigkeit der Kleidung eignete sich nun einmal nicht für sie.
So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen. Und wer findet eigentlich, dass Frau Stöhr sich mit ihren Schwabbelarmen keine durchbrochenen Ärmel leisten kann – ist es die versammelte Gesellschaft oder der Autor? Die Art und Weise, wie Thomas Mann seine Figuren beurteilt, wie er sie nicht einfach leben lässt, sondern Schulnoten verteilt – das gehört wohl zu den Dingen, die ich an seinem Schreiben nicht mag.
Der Modekatalog geht weiter, denn auch die „Herrenwelt des Sanatoriums“ ist sommerlich gekleidet, bzw.
[sie] hatte der schönen Witterung auf verschiedene Weise in ihrem Äußeren Rechnung getragen
(Nun ja, geht’s sprachlich auch eine Nummer kleiner?)
Lüsterjacken und leinene Anzüge waren aufgetaucht, und Joachim Ziemßen hatte elfenbeinfarbene Flanellhosen zu seinem blauen Rock getragen, eine Zusammenstellung, die seiner Erscheinung ein vollständig militärisches Gepräge verlieh.
Nichts Aufregendes, doch der Satz tut, was er soll: Ich habe ein Bild vor Augen (wenn es mich auch etwas seltsam berührt, dass Jacken und Anzüge „auftauchen“).
Im nächsten Satz kommt endlich Leben in die Szenerie, denn endlich spricht jemand: Settembrini hatte schon vorher die Absicht geäußert, den Anzug zu wechseln, so erfahren wir.
„Teufel!“ hatte er gesagt, als er nach dem Lunch mit den Vettern in den Ort hinunterpromenierte, „wie die Sonne brennt! Ich sehe, ich werde mich leichter kleiden müssen.“
Was er dann allerdings doch nicht tut.
[Er hatte] nach wie vor seinen langen Flaus mit den großen Aufschlägen und seine gewürfelten Beinkleider anbehalten […].
Das Interesse des Autors für die Beinkleider, durchbrochenen Ärmel, Flaus und Lüsterjacken seiner Figuren scheint mir penetrant (vielleicht sind seine Bücher deshalb so dick?). Es ist eine Technik der Vergegenwärtigung, für die ich mich nicht begeistern kann, bei aller Bewunderung.
Großartig finde ich dagegen den Schluss dieser Seite. Es ist ein Satz, der Anlauf nimmt, Kräfte sammelt und an Tempo gewinnt – in perfekter Übereinstimmung von Form und Inhalt, denn der Satz inszeniert das Wetter, das sich hier entfesselt:
Es war nach der Hauptmahlzeit, und man befand sich seit zwanzig Minuten in der Liegekur, als die Sonne sich eilig verbarg, häßlich torfbraunes Gewölk über die südöstlichen Kämme heraufzog und ein Wind von fremder Luftbeschaffenheit, kalt und das Gebein erschreckend, als käme er aus unbekannten, eisigen Gegenden, plötzlich durch das Tal fegte, die Temperatur umstürzte und ein ganz neues Regiment eröffnete.
„Schnee“, sagte Joachims Stimme hinter der Glaswand.
Auch die Landung ist perfekt: Das Wort „Schnee“ genügt, um die Szene (und vielleicht das Schicksal dieser achso munteren Gesellschaft) zu besiegeln.
Fazit: Ein Könner, den ich doch wiedermal lesen sollte.
Thomas Mann
Der Zauberberg
Roman
Fischer Taschenbuch 1991 · 1008 Seiten · 18 Euro
ISBN: 978-3596294336
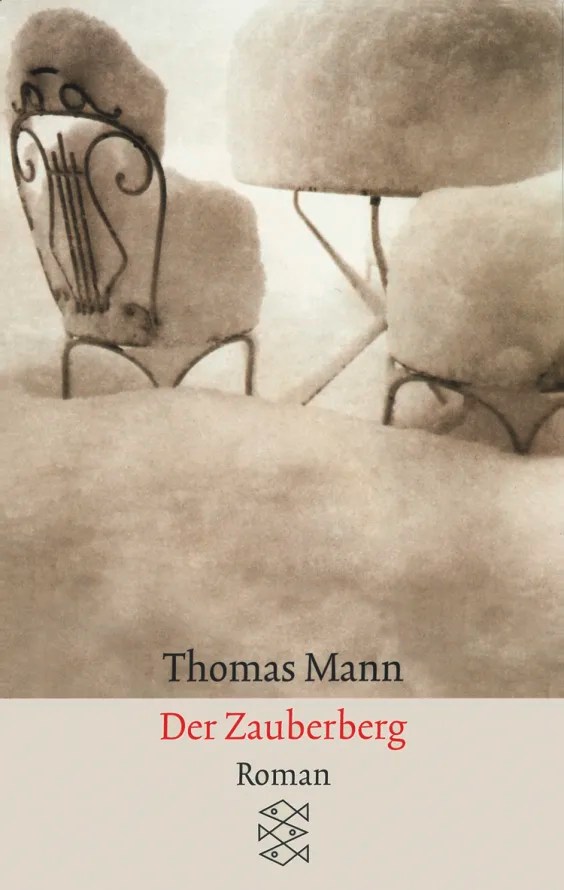


Danke für diese genaue Analyse, die mir mal im Einzelnen erläutert, weshalb mich Thomas-Mann-Lektüre immer fasziniert, gleichzeitig aber auch ärgert: auf der einen Seite sein Witz und seine originellen, dramaturgisch äußerst geschickt eingesetzten Beschreibungen, auf der anderen Seite der abfällige Umgang mit seinen Figuren (insbesondere, wenn es Frauen sind). Das mit der Mode- und Designbegeisterung Manns, das war mir bisher noch nicht bewusst – aber ja, Sie haben Recht, das nervt, es ist ein bisschen spießig.
“Spiessig” im Sinn von kleinbürgerlich? Ich würde dies “auffallend” nennen. Jedenfalls berührt es Sie, wenn auch primär Ihre Nerven.
Ich meinte “spießig” im Sinne von schulmeisternd (Noten verteilend, wie im Artikel oben dargelegt), streberhaft (ich weiß Bescheid), aber auch kleinlich sammelwütig – wie gesagt, Witz und Eleganz der Sprache machen das bei Mann oft wett, leider nicht immer.